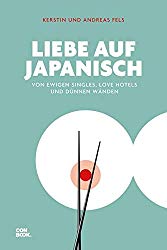Nervös streicht Herr Uchida seine taubengraue Krawatte glatt. Er beobachtet im Rückspiegel einen Streifenpolizisten, der, seit er sein kōban-Häuschen verlassen hat, die Reihe der geparkten Fahrzeuge gemessenen Schrittes entlangschreitet.
»Wo bleibt Akiko nur?«, fragt sich der seinem Gefühl nach jung gebliebene Übersetzer, der im 460 Kilometer entfernten Tōkyō bei einem Chemiekonzern angestellt ist. Allein schon angesichts der Tatsache, dass er dort bereits seit 1989 arbeitet, hält sein aktuelles Gefühl einem ehrlichen Realitätscheck nicht stand. Doch egal, heute fühlt er sich jung. Und gestresst.
Jetzt steht er schon eine Viertelstunde hier herum und wartet auf sie. Auch wenn er eine halbe Stunde zu früh gekommen ist, weil er den deutlich geringeren Verkehr hier in der alten Kaiserstadt Kyōto nicht gewohnt ist, weiß sie doch, dass er hier nur ganz schlecht parken kann.
Nur noch vier oder fünf Autolängen Abstand zu dem Mann in der dunkelblauen Uniform. Ballt er seine weiß behandschuhte Hand zu einer Faust? Ahnt er etwas? Jetzt fühlt sich die Krawatte an seinem Hals viel zu eng gebunden an. Oder sein Hals ist plötzlich auf den doppelten Umfang angeschwollen. Wird er ihn jetzt festnehmen wegen der Sache mit Akiko?
Ihm schießt durch den Kopf, warum viele japanische Streifenpolizistenim Dienst weiße Handschuhe tragen. Er hat mal gelesen, dass die Beatles daran schuld sein sollen.
Wie die Beatles Japan für immer veränderten
Die vier Musiker aus Liverpool hatten gerade mit Songs wie Paperback Writer, Day Tripper und Yesterday Auftritte in München, Essen und Hamburg absolviert. In jeder dieser Städte waren die Britpopper von riesigen Trauben vornehmlich weiblicher Fans kreischend empfangen worden. Und genau das machte Hideo Yamada sehr nervös.
Er war beim ersten Japanbesuch der »Pilzköpfe« im Juni 1966 als Polizist für die Sicherheit der international erfolgreichen Superstars zuständig. Es hatte bereits viele Diskussionen wegen des Besuchs der Popmusiker gegeben. Der verlorene Zweite Weltkrieg spukte noch in den Köpfen vieler Menschen herum und war auch in Medien und Politik noch sehr präsent. Konservativen bereitete es Sorge, dass sich gerade junge Menschen offenbar nicht mehr mit der Schmach der Niederlage auseinandersetzen wollten und sich begeistert dem Lifestyle der einstigen Gegner – Coca-Cola, westliche Mode und Popmusik – zuwandten. Und da hatten die Beatles gerade noch gefehlt, da sie all das repräsentierten, was Traditionsbewahrern ein Dorn im Auge war und daher als schlechter Einfluss wahrgenommen wurde. Als zusätzlichen Affront empfanden nicht wenige, dass die Band im Nippon Budōkan in Tōkyō auftreten sollte, einem Veranstaltungsort, der sonst nur für Kampfkunstevents genutzt wurde und als Shintō-Schrein auch zur Verehrung von Kriegstoten. Doch das Budōkan war zu dieser Zeit die einzige Halle in Japan mit einer Kapazität von 10.000 Zuschauern. Und diese mögliche Zuschauerzahl hatte Beatles-Manager Brian Epstein als Mindestgröße für einen Japanauftritt seiner Künstler als Bedingung genannt. Nationalisten forderten lautstark, den Auftritt der überbeliebten Westler abzusagen. Noch in Hamburg erhielt Epstein einen Brief, dass seine Künstler der Tod erwarte, sollten sie tatsächlich nach Japan kommen.
Wegen dieser Drohung und der allgemein sehr aufgeheizten Stimmung wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die denen der vorangegangenen Olympischen Spiele von 1964 in kaum etwas nachstanden: 35.000 Mitarbeiter der Polizei und Feuerwehr sollten einen reibungslosen organisatorischen Ablauf des Konzerts sicherstellen.
Was Herrn Yamada dabei besonders nervös machte, waren aber nicht die Ewiggestrigen, die ultrarechten Studenten und Vertreter der japanischen kommunistischen Partei, die sich um eine Entweihung des Budōkan und vor allen Dingen um den Verlust der nationalen Identität
sorgten, sondern die jungen weiblichen Fans. In der Zeitung hatte der Polizist gelesen, welche Wirkung die musizierenden Mittzwanziger auf Frauen hatten. Er wusste: Um die Menge in Zaum zu halten, würde man die kreischenden Fans zurückdrängen müssen. Aber wie sollte man bei solchem Körperkontakt reigi tadashisa wahren, die Etikette? Er erinnerte sich daran, wie es die kaiserliche Garde machte, und verordnete diese Lösung den ihm unterstellten Polizeibeamten: weiße Handschuhe.
Die Beatles setzten sich am Vormittag des 3. Juli nach fünf Konzerten im Nippon Budōkan und ohne Sicherheitsprobleme in einen Flieger nach Manila, wo sie ihre Tournee fortsetzten. Die weißen Handschuhe als Mittel zur Wahrung des formalen Anstands und der Etikette sind indes bis heute geblieben.
Mit einem lauten Geräusch öffnet sich die Beifahrertür von Herrn Uchidas Auto, und er wird aus seinen Gedanken gerissen, die er mit einem gesummten »Love me do« untermalt hatte. »Was ist das für ein Lied?«, fragt Akiko mit interessiert aufgerissenen Augen. »Kenne ich das?« Herrn Uchidas Blutdruck sinkt augenblicklich, als er in das jugendliche Gesicht seiner Begleiterin schaut. »Doch nicht der Polizist«, murmelt er halblaut und dreht mit zittriger Hand den Zündschlüssel. Akiko quittiert die letzte Bemerkung mit einem fragenden Blick, beginnt aber, anstatt auf eine Erklärung zu warten, von ihrem Tag zu erzählen – der offenbar sehr aufregend war, nach der Höhe ihrer Tonlage zu urteilen. Im Rückspiegel sieht Herr Uchida noch, wie die hell leuchtenden Handschuhe des Streifenpolizisten mit zunehmender Entfernung in der noch jungen Nacht im Zentrum Kyōtos immer weiter verblassen.
Wenig später lenkt Herr Uchida seinen Kleinwagen in einen der wenigen freien Plätze in einem engen Parkhaus. Als der Motor verstummt und die Handbremse knarzend ihren Dienst antritt, schaut er Akiko an und überlegt, ob es angemessen wäre, sie zur Begrüßung an ihrem nackten Oberarm zu berühren. Sie erzählt immer noch von ihrem ausgedehnten Einkauf bei Daimaru. Bevor sie in das exklusive sechsstöckige Kaufhaus ging, hatte sie schon auf der anderen Straßenseite bei Louis Vuitton angestrengt nach Möglichkeiten gesucht, Geld auszugeben. Bis sie dann endlich in der Gucci-Abteilung des Daimaru fündig wurde und einen traumhaften Rock erstand – dank eines »June Special Sale« sogar 5.000 Yen günstiger als normal. Als sie den Preis nennt, wird Herr Uchida aus seinen Gedanken gerissen, die in den letzten Minuten mehr um Akikos faltenlose Gesichtszüge kreisten als um ihre Einkaufserfolge. Er greift zum Rücksitz, auf dem ein sorgfältig eingepacktes Geschenk des Luxusschneiders Minoya liegt. Stolz und mit der eher unbegründeten Hoffnung, die junge Frau später noch in dem neuen, jahreszeitlich gemusterten Seidenkimono im gemeinsamen Zimmer des Boutique-Hotels Suiran zu sehen, überreicht er das weiche Paket.
Akiko unterbricht ihre von der Erwähnung von Luxusmarken geprägte Einkaufsgeschichte und verstaut nach einer angedeuteten Verbeugung und höflichen Dankesworten das Geschenk unausgepackt in ihrer großen Prada-Tasche. »Wollen wir jetzt essen gehen?« Herr Uchida nickt pflichtbewusst.
Als sie kurz darauf in einem Restaurant mit Kerzenschein und französischer Küche Platz nehmen, sind Herrn Uchidas Zweifel wegen Akiko und seiner zu Hause in Tōkyō wartenden Ehefrau wieder verflogen. Die musternden Blicke der Gäste und des Personals waren nicht zu übersehen. Ihm gefällt die Vorstellung, dass einige von ihnen vielleicht denken, er sei ein erfolgreicher, smarter Typ, der alle haben könne, auch die hübschen und wesentlich jüngeren Frauen. Als eine dieser jungen und hübschen Frauen hat Akiko natürlich auch die Blicke der anderen mitbekommen, als sie das Restaurant betraten. Sie bemerkt, dass manche sich sicherlich fragen, ob hier Vater und Tochter zusammen speisen oder eben doch ein Pärchen mit einem Glas Champagner als Aperitif dem selbst gesetzten Anspruch nachkommt, einen Abend wie Gott in Frankreich zu verbringen. Sollen sie doch. Sie weiß ja, dass Herr Uchida weder ihr Vater noch ihr Partner ist. Er ist einfach … ja, was eigentlich?
Akiko und Herr Uchida pflegen eine nicht nur wegen des großen Altersunterschieds besondere Beziehung. Streng genommen sind sie Geschäftspartner: Sie gibt ihm ihre Gesellschaft im Austausch gegen Geschenke oder Geld. Japaner nennen diese Übereinkunft enjo kōsai, »Dating mit Kompensation«.
Wer hierbei an einen Escortservice denkt, liegt bei der japanischen Spielart enjo kōsai nicht ganz richtig. Anders als bei jener Art des Begleitservices sind die Zusammenkünfte bei der japanischen Variante nicht gewerblich organisiert. Die Mädchen treffen sich aus privatem Antrieb und Interesse mit ihren Partnern. Problematisch an diesen Verbindungen ist, dass die Frauen meist noch sehr jung sind, nicht selten Oberschülerinnen. Das macht das Ganze moralisch bedenklich und rückt es gesetzlich zumindest in eine Grauzone – besonders dann, wenn die Treffen nicht nur gemeinsames Kaffeetrinken und Essengehen beinhalten, sondern auch Sex.
Tatsächlich sind Japaner erst mit vollendetem 20. Lebensjahr von Gesetzes wegen erwachsen. Aber natürlich steht es ihnen frei, auch vor Erreichen dieser Altersgrenze erwachsene Dinge zu tun. § 45 des Strafgesetzes verfolgt und bestraft nur solche »unanständigen Handlungen«, an denen Personen unter 13 Jahren beteiligt waren – unabhängig davon, ob diese Handlungen einvernehmlich stattfanden oder erzwungen wurden. Das Kinderfürsorgegesetz ergänzt in diesem Zusammenhang, dass Personen unter 18 Jahren »obszöne Handlungen « untersagt sind. In Bezug auf das auf Harmonie ausgerichtete Gemeinwesen Japans ist das so zu deuten, dass diese Handlungen keine Unbeteiligten belästigen dürfen, wie dies zum Beispiel bei Sex in der Öffentlichkeit oder offener Straßenprostitution der Fall wäre.
Sexueller Verkehr mit Minderjährigen wird bei uns sowohl moralisch als auch strafrechtlich zweifelsfrei als Pädophilie beurteilt. Doch auch der moralische Kompass ist in Japan in dieser Hinsicht anders geeicht als im Westen – was immer wieder auch Anlass für Kritik aus dem Ausland ist. Schon im Jahr 2015 hatte die niederländische Juristin Maud de Boer- Buquicchio in ihrer Funktion als Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu den Themen Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie ihre Bedenken hinsichtlich des enjo kōsai öffentlich gemacht. Dabei berichtete sie, dass 13 Prozent aller Schulmädchen in Japan Geld oder Sachgeschenke für Treffen mit älteren Männern erhielten. Japans Außenministerium wollte de Boer-Buquicchios Äußerung nicht unkommentiert lassen und beschwerte sich in einer ei gens einberufenen Pressekonferenz über de Boer-Buqicchios Äußerung. Dabei wurde das Phänomen an sich nicht bestritten und der implizite Vorwurf, dass es sich hierbei um eine Form der Kinderprostitution handeln könnte, nicht weiter kommentiert. Doch wollte man den genannten Prozentwert so nicht stehen lassen und forderte die UN-Berichterstatterin dazu auf, ihre Quellen offenzulegen. Nicht nur das Außenministerium, sondern auch viele japanische Medien arbeiteten sich an diesen 13 Prozent ab. Der allgemeine Tenor lautete, dass westliche Medien und Meinungsmacher dazu neigten, Zahlenmaterial falsch zu interpretieren und für eine spannende Story die Tatsachen zu verfälschen oder aus dem Kontext herauszureißen. Der offizielle Protest des japanischen Außenministeriums hatte zur Folge, dass de Boer-Buquicchio ihre Aussage zurücknahm.
Auch wenn kontrovers diskutiert wurde, wie viele tatsächlich enjo kōsai betreiben, so bestritt niemand, dass sich Mädchen gegen Geld oder Geschenke mit älteren Herren treffen und dass diese häufig noch nicht erwachsen sind.
Okay, aber warum machen Akiko und andere Mädchen das überhaupt? Für die meisten dürfte ein vergnügungsorientierter Lifestyle und das hierfür benötigte Geld das Hauptmotiv dafür sein, sich auf enjo kōsai einzulassen. Und der Grund dafür, dass sie diese Art des Geldverdienens wählen, ist ganz einfach: Regulären Beschäftigungen darf man in Japan erst ab dem 16. Lebensjahr nachgehen. Greift der Konsumdruck schon früher, können nur Erspartes, die Eltern oder eben eine Einnahmequelle wie enjo kōsai die drängenden Bedürfnisse befriedigen.
Namie, eine Freundin von Akiko, hatte ihr irgendwann im Kino davon erzählt, dass sie enjo kōsai ausprobiert habe. Als Ryan Gosling gerade sein T-Shirt abstreifte, hatte Akiko keine Augen für die definierte Bauchmuskulatur des Schauspielers, sondern war mit ihrer Aufmerksamkeit nur bei Namie. Die erzählte ihr unter anderem, dass das enjo kōsai bereits 1996 in Tōkyōs Stadtteilen Shibuya und Shinjuku seinen Anfang nahm, ebenjenen Vierteln, die seit jeher von Vergnügen und Shoppingmöglichkeiten geprägt sind.
Die Kinder derjenigen, die in den 80er-Jahren die Blüte der japanischen Wirtschaft miterlebt und sich einen entsprechend konsumfreudigen Lebensstil angeeignet hatten, standen plötzlich vor dem Problem, dass nach wie vor Marken- und Luxusprodukte mit starken »Kauf mich«-Impulsen lockten, aber seit dem Platzen der Wirtschaftsblase das dafür notwendige Geld nicht mehr im selben Umfang zur Verfügung stand wie zuvor. Was also tun? Sich in Verzicht üben? Für Mädchen wie Namie, die die anerkennenden Blicke der Freundinnen in der Schule genießen möchten, keine Option. Dann lieber mit genau den Männern der Elterngeneration treffen, die am Aufbau und am Zusammenbruch der Bubble Economy beteiligt waren, und für ein Treffen mit 25.000 bis 50.000 Yen (circa 190 bis 385 Euro) ein kleines Vermögen kassieren – ohne die Notwendigkeit, es dabei zu sexuellen Handlungen kommen zu lassen.
Für Akiko war die Sache schnell klar: Noch am Abend des Kinobesuchs registrierte sie sich bei einer Internetplattform, die wie viele andere ihrer Art auf die Anbahnung solcher Zweckbekanntschaften spezialisiert ist. Bei dieser deai-Seite (von deau = sich treffen) hinterlegte sie schnell ein paar spärliche Informationen sowie ihre Mobilnummer. Als das Telefon schon eine Viertelstunde später klingelte, zog sie ihr pinkfarbenes Smartphone mit zitternden Fingern aus der Manteltasche – und spürte eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung darüber, dass nur Namie dran war. Herr Uchida, der geschäftlich hin und wieder in Kyōto ist, war einer der Ersten, der sie anrief. Er hat eine nette, sanfte Stimme. Sie traf sich mit ihm an einem der touristischen Hotspots der Stadt. Nicht dass sie sich Sorgen um ihre Sicherheit gemacht hätte – Kentarō, kurz Ken, wie er sich dann gleich bei ihrem Treffen vor dem Kiyomizu-dera mit nervösem Blinzeln vorstellte, hatte einfach nicht die Stimme eines Serienmörders. Akiko glaubt, so etwas an der Stimme eines Mannes erkennen zu können.
Im Menschenstrom der japanischen und weit gereisten Touristen am Pfahlbautempel konnten sich die beiden vorstellen, sie seien einfach nur ein ganz normales Paar mit gut 30 Jahren Altersunterschied, das sich irgendwo zufällig trifft und sich miteinander amüsiert.
Ob das in den Anfangsjahren von enjo kōsai auch so unkompliziert abgelaufen wäre? Da steckte das Internet noch in den Kinderschuhen, und so gab es für die Anbahnung der Bekanntschaften die sogenannten terekura, »Telefonclubs «. Wollte ein Mann in den späten 90ern eine zeitweilige Begleitung für Freizeit und / oder Bett finden, führte der Weg über die Mitgliedschaft in einem der besagten Clubs. Gegen ein Wartegeld von etwa 3.000 Yen pro Stunde konnte der Kontaktsuchende in einem kleinen Raum Platz nehmen, dort Pornofilme konsumieren und hoffen, dass das in dem Raum aufgestellte Telefon möglichst bald klingeln würde. Kontaktsuchende Frauen wiederum riefen über eine kostenlose Nummer in der Zentrale des Clubs an und wurden von den Telefonisten zu den Kabinen durchgestellt. War man sich beim Telefonat sympathisch, konnte direkt ein Treffen verabredet werden. Lief es nicht so gut, ließen sich die Mädchen mit einem anderen Clubbesucher verbinden, und für den Mann ging das Warten auf eine spannende Anruferin in die nächste Runde.
Auf ein Handzeichen von Herrn Uchida tritt ein Kellner an den Tisch des ungleichen Paars, und Akiko nutzt die Gelegenheit, sich ein exotisch klingendes Dessert zu bestellen. Als die Bedienung nach einer angedeuteten Verbeugung Akikos Wunsch an die Küche weitergibt, bemerkt sie, dass Kens Blicke nicht nur auf ihrem Gesicht ruhen, sondern auch über die Arme ihres schulterfreien Kleides und die Region darunter gleiten. Aber zum Sex wird es heute nicht kommen, da braucht er sich keine Hoffnungen zu machen. Nicht dass Akiko grundsätzlich ein Problem damit hätte, mit einem älteren Mann zu schlafen. Das könnte sie, es ist ihre Entscheidung. Manche Medien – und gerade männliche Kommentatoren – sehen genau darin einen Verfall der Sitten, während Frauen, die sich in Zeitungen und im Fernsehen zum Thema enjo kōsai äußern, auffallend oft eine Vernachlässigung der Mädchen in der Kindheit vermuten. Unfug. Sie sieht sich nicht als Prostituierte. Wenn sie einen Mann mit der Hand befriedigt oder mit ihm schläft, dann bekommt sie die Kompensation nicht von einem Fremden. Sie kennen sich. Sie empfindet keine Schuld bei dem Deal »Geld und Geschenke gegen Gesellschaft«. Und auch wenn sie nie anderen oder gar ihren Eltern erzählen wird, wie sie sich die tollen Klamotten und Accessoires leisten kann, weiß sie, dass es auch kaum jemanden stören würde. Es ist nicht ungesetzlich, und in einer auf Harmonie fußenden Gesellschaft ist nahezu jede Handlung in Ordnung, solange durch das eigene Handeln niemand gestört wird.
Dazu fällt ihr ein Artikel ein, den sie vor ein paar Wochen auf der Internetseite einer bekannten Tageszeitung gelesen hat. Ein buddhistischer Mönch fing demnach zur Finanzierung seiner kostspieligen enjo kōsai-Bekanntschaft an, Geldscheine zu fälschen, und gab auch dieser Freundin mehrere falsche 10.000-Yen-Noten. Die bemerkte den Schwindel und ging mit den Blüten zur Polizei, die ihren Liebhaber festnahm – nicht weil er mit einer Minderjährigen Sex hatte, sondern weil er sie hierfür mit Falschgeld entschädigen wollte. Warum sollte Akiko also Schuldgefühle haben, weil sie sich mit Männern wie Ken trifft?
Bevor sie weiter über diese Frage und die moralisch höchst fragwürdige Rolle der Männer in solchen Beziehungskonstrukten nachdenken kann, stellt der Kellner die cremige Süßspeise vor ihr auf den Tisch. Und mit einem Mal ist die Welt für sie noch ein bisschen mehr in Ordnung.
Dieses Kapitel ist ein Auszug aus dem Buch „Liebe auf Japanisch: Von ewigen Singles, Love Hotels und dünnen Wänden“, das im Conbook Verlag erschienen ist.
Info Box
Liebe auf Japanisch: Von ewigen Singles, Love Hotels und dünnen Wänden
Autoren: Kerstin und Andreas Fels
April 2019 (1. Auflage)
Taschenbuch, 256 Seiten
ISBN: 978-3958892002
9,95 Euro